Möchten Sie die Darstellung der Website ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen?
Die Einstellungen können Sie auch später noch über das Symbol
ändern.
17. Usher-Café: Pflegegrad 1 – was bedeutet das konkret bei Sehbehinderung und Blindheit?
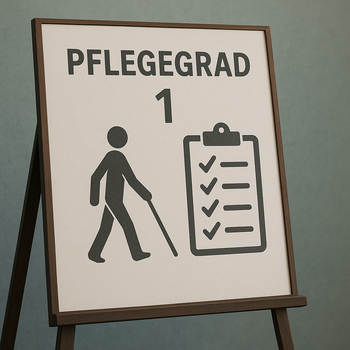
Pflege – ein komplexes System
Zunächst wurde klargestellt: Pflegeleistungen müssen beantragt werden. Ohne Antrag gibt es keine Leistung – ein Grundsatz des Sozialrechts. Und dieser Antrag erfordert Vorbereitung: Betroffene sollten sich im Vorfeld Gedanken machen, in welchen Lebensbereichen sie konkret Unterstützung benötigen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst, bei der festgestellt wird, wie stark die Selbstständigkeit einer Person eingeschränkt ist. Dabei geht es nicht um die Diagnose selbst (z. B. Blindheit), sondern um deren konkrete Auswirkungen auf den Alltag.
Was ist ein Pflegegrad?
Seit der Pflegereform 2017 wird nicht mehr von Pflegestufen, sondern von Pflegegraden gesprochen. Der Pflegegrad 1beschreibt eine „geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“. Besonders interessant: Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung oder Blindheit, die eine umfassende Rehabilitation durchlaufen haben, erreichen häufig nicht automatisch die notwendige Punktzahl.
Die sechs Module der Pflegebegutachtung
Josef Schwietering stellte ausführlich die sechs Module vor, die bei der Begutachtung bewertet werden:
- Mobilität (z. B. von einem Stuhl aufstehen, Treppensteigen)
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (z. B. Personen erkennen, zeitlich orientiert sein, an Gesprächen teilnehmen)
- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (z.B. Ängste, Rückzug)
- Selbstversorgung (z.B. Körperpflege, Ankleiden, Nahrungsaufnahme )
- Bewältigung von krankheitsbedingten Anforderungen (z. B. Medikamenteneinnahme)
- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Seh- und Höreinschränkungen können Auswirkungen auf den Pflegegrad haben, da sie die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten der Betroffenen beeinflussen können. Bei vorliegen einer Seh- und Höreinschränkung kann die Selbstständigkeit deutlich stärker eingeschränkt sein!
Pflegegrad 1 – Was bekommt man?
Pflegegrad 1 bietet keine Geldleistung im klassischen Sinne, sondern einen Entlastungsbetrag von derzeit 131 Euro monatlich (Stand: Januar 2025). Dieser kann für haushaltsnahe Dienstleistungen, Einkaufshilfen, Alltagsbegleitung etc. eingesetzt werden. Josef Schwietering wies mehrfach darauf hin, dass dieser Betrag angespart werden kann. Die nicht genutzten Entlastungsbeträge können in den Folgemonaten und auch ins nächste Jahr übertragen werden. Sie müssen bis zum 30. Juni des Folgejahres verbraucht werden!
Ein wichtiger Hinweis: Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist nicht verpflichtend, aber wer dauerhaft keine Leistungen abruft, sollte mit einer Überprüfung des Pflegegrades rechnen.
Pflege, Assistenz, Blindengeld – was ist was?
Im weiteren Verlauf des Treffens wurde deutlich, dass es Überschneidungen zwischen Pflegeleistungen, Assistenzleistungen und dem Blindengeld gibt. Während Assistenz vor allem auf gesellschaftliche Teilhabe zielt, bezieht sich Pflege auf Hilfe bei Körper nahen oder krankheitsbedingten Tätigkeiten.
Blindengeld ist ein Nachteilsausgleich, der dem Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen dient, und kann auch zur Finanzierung von Assistenz eingesetzt werden. Ab Pflegegrad 2 wird das Blindengeld in vielen Bundesländern anteilig angerechnet – nicht jedoch bei Pflegegrad 1.
Fazit und Ausblick der AK Leitung
Der Vortrag machte deutlich: Der Pflegegrad 1 ist kein Allheilmittel, aber ein erster Schritt, um Unterstützungsleistungen zu beantragen und den Alltag besser zu bewältigen – gerade bei zunehmender Seh- oder Hörsehbehinderung. Der Zugang zu Leistungen ist allerdings oft mit Bürokratie und unklaren Zuständigkeiten verbunden. Umso wichtiger ist eine gute Beratung, wie sie etwa durch den Arbeitskreis Soziales der Pro Retina oder durch die EUTB-Stellen angeboten wird.
Das Usher-Café bot erneut einen Raum für Austausch, Information und gegenseitige Unterstützung. Unser besonderer Dank gilt Josef und Brigitte Schwietering für ihren kenntnisreichen und engagierten Beitrag!
Hinweis: Bei Fragen zum Vortrag oder individuellen Anliegen können sich Mitglieder weiterhin an die bekannten Ansprechpartner im Arbeitskreis Soziales wenden.
(Texte und Bild wurden mit ChatGPT erstellt, die Texte wurden menschlicherseits überarbeitet)